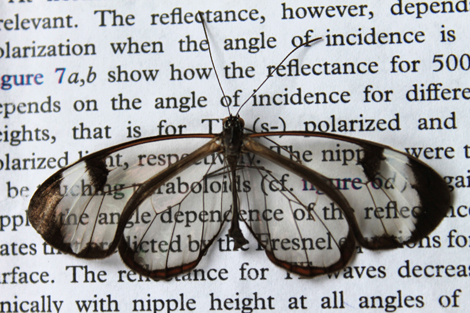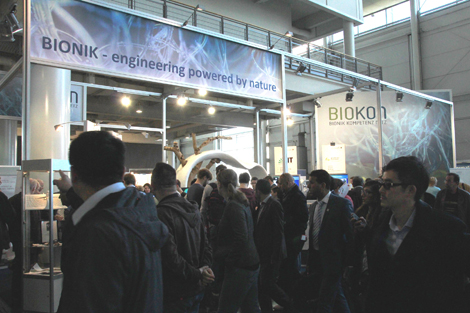Presse // 17. Dezember 2015
3D-Druck im zivilen Flugzeugbau – eine Fertigungsrevolution hebt ab
Für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten nominiert und von der Jury in den „Kreis der Besten“ aufgenommen wurden BIOKON-Mitglied Airbus, LZN Laser Zentrum Nord und Concept Laser mit ihrer gemeinsamen Entwicklung zum 3D-Drucken. Ihnen gelang es, ein dreidimensionales gedrucktes Flugzeugbauteil aus Metall zu fertigen – einen Kabinenhalter aus Titan.
Airbus – und auch anderen Industriezweigen in Deutschland – steht damit ein neues Produktionsverfahren zur Verfügung, das weit mehr Möglichkeiten bietet als herkömmliche Fertigungsverfahren. Mit dieser neuen Verfahrenstechnik werden Produkte nicht aus einem Materialstück herausgestanzt, -gefräst oder -geschnitten, sondern Schicht für Schicht aufgebaut.
Das bringt etliche Vorteile: Material- und Energieverbrauch sind deutlich geringer, was Ressourcen und Klima schont. Zudem haben die Konstrukteure mehr Freiheit bei der Gestaltung der Bauteile. Und: Prototypen, Einzelstücke oder Kleinserien von Produkten lassen sich einfach und günstig herstellen.
3D-Druck im Metallbereich − reif für die industrielle Serienproduktion
Flugzeugbau stellt hohe Ansprüche an Konstruktion und Fertigung. Die Herausforderung: Komplexe Flugzeugteile effizient, kostengünstig und möglichst umweltschonend herzustellen. Peter Sander, Leiter des Bereiches Emerging Technologies & Concepts bei Airbus, Claus Emmelmann als CEO des LZN Laser Zentrum Nord sowie Leiter des Instituts für Laser- und Anlagensystemtechnik der TU Hamburg-Harburg und Frank Herzog als Geschäftsführer von Concept Laser im oberfränkischen Lichtenfels haben dieses Verfahren mit ihren Teams entwickelt und es zur Anwendungsreife geführt: Airbus setzt das gemeinsam geschaffene Verfahren erstmals zur Herstellung eines Kabinenhalters aus Titan ein. Er dient dazu, den Crew-Ruheraum an Bord des neuen Langstreckenflugzeugs A350 XWB zu befestigen, und ist seit 2014 im Einsatz.
Das sogenannte „LaserCUSING®“ reduziert als „grüne Technologie“ nicht nur den ökologischen Fußabdruck der Fertigung, sondern verkürzt auch Ausfallzeiten der Flugzeuge während der Wartung: Benötigte Ersatzteile lassen sich nach Bedarf sofort und vor Ort drucken.
Bei Airbus plant man, den 3D-Druck künftig zur Herstellung weiterer Komponenten zu verwenden – und das innovative Verfahren zu nutzen, um neuartige konstruktive Elemente zu realisieren. Diese bionische Konstruktionsmethodik, entwickelt am LZN, ermöglicht nach dem Vorbild der Natur geformte Bauteile zu kreieren und damit bis zu 80% Gewicht zu sparen. Die so erzielte Gewichtsreduktion trägt maßgeblich zur Reduktion des CO2-Ausstoßes der kommenden Flugzeuggenerationen bei.
Neue Verfahrenstechnik: Schicht für Schicht − Bauteile aus Metall
Allerdings kamen bisher nur bestimmte Werkstoffe für die „additive Fertigung“ in Frage, etwa Kunststoffe oder leicht schmelzbare Legierungen. Durch das neue Verfahren können im 3D-Druck auch mechanisch und thermisch hoch-belastbare metallische Bauteile produziert werden. Das „LaserCUSING®“-Verfahren eignet sich etwa für verschiedene Stähle, Edelmetalle wie Gold- und Silberlegierungen sowie Legierungen auf Basis von Titan. Die Verarbeitung von Titan stellt jedoch sowohl konventionelle Fertigungsverfahren als auch das „LaserCUSING®“-Verfahren vor große Herausforderungen. Die intensiven Verfahrensentwicklungen vom Laser Zentrum Nord und Concept Laser, in enger Kooperation mit Airbus, ermöglichen nun eine qualitätsgesicherte Fertigung metallischer Bauteile für die Luftfahrt.
Pulverförmiges Metall wird mit dem energiereichen Licht eines Faserlasers bestrahlt und dadurch aufgeschmolzen. Nach dem Erkalten verfestigt sich das Material. Der Laser streicht computergesteuert Zeile für Zeile über das Metallpulver und lässt so die gewünschte Form entstehen. Um das komplette Produkt aufzubauen, wird es nach Fertigstellung jeder Schicht um einige Dutzend Mikrometer abgesenkt und danach die nächste Lage aufgebracht. Eine patentierte „stochastische“ Ansteuerung stellt sicher, dass sich auch große Bauteile, wie sie im Flugzeugbau benötigt werden, weitgehend spannungsfrei drucken lassen.
Digitale Innovation
Kern der Innovation ist der vollständig digitale Charakter des Fertigungsverfahrens. Damit lässt sich der 3D-Drucker in eine durchgängige digitale Prozesskette einbinden, bei der die einzelnen Herstellungsschritte samt Materiallogistik und Qualitätsprüfung automatisch ablaufen und aufeinander abgestimmt sind. Das revolutionäre Konzept, dessen Entwicklung und Umsetzung Forscher und Unternehmen in Deutschland führend vorantreiben, verwirklicht das Prinzip der Industrie 4.0.
Wachsender Markt
Die Bedeutung des 3D-Drucks von metallischen Produkten reicht weit über den Flugzeugbau hinaus. Die Technologie wird voraussichtlich in vielen Branchen wie dem für Deutschland besonders wichtigen Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Medizintechnik konventionelle Fertigungsmethoden ersetzen oder ergänzen. Fachleute erwarten, dass der Markt für den 3D-Druck in den nächsten Jahren auf das Fünffache wachsen wird.
Quelle: Presseservice Deutscher Zukunftspreis